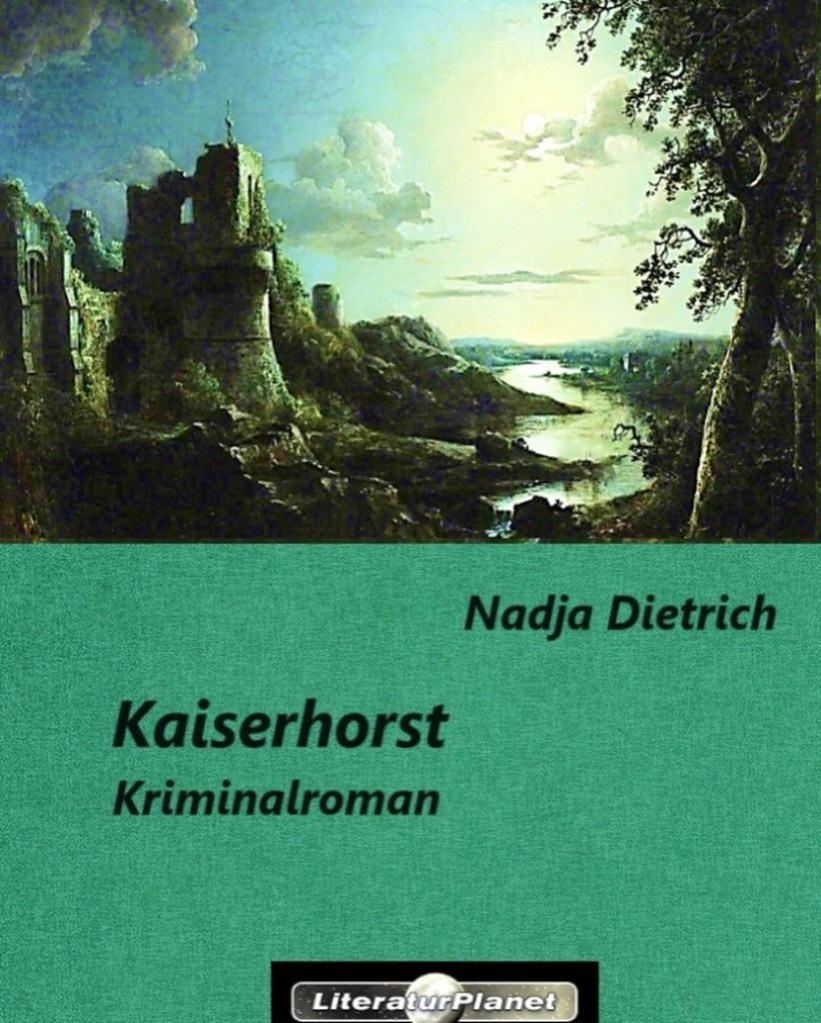Auszug aus Nadja Dietrichs Roman Kaiserhorst
Teil 1 von Nadja Dietrichs Roman Kaiserhorst spielt in der Psychiatrie. Je länger der Tagebuchschreiber und Protagonist des Romans darin festgehalten wird, desto mehr färbt das Bild, das dort von ihm entworfen wird, auf ihn ab.
Je länger ich in dieser Anstalt bleiben muss, desto mehr beginne ich daran zu zweifeln, ob die Bilder in meinem Kopf mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Es ist wie bei einem Farbenblinden, der zusammen mit 99 anderen, nicht farbenblinden Menschen ein Gemälde betrachtet. Irgendwann wird er eben doch einsehen, dass er die Farben nicht so sieht, wie sie in Wirklichkeit sind.
Nein, der Vergleich ist schlecht gewählt! Bei dem Farbenblinden beruht die abweichende Wahrnehmung ja auf einer organischen Anomalie, die man ihm gegebenenfalls nachweisen kann, wenn er auf der „Wahrheit“ des von ihm Wahrgenommenen besteht.
Außerdem geht es in diesem Fall ja nur um eine Nuance der Wirklichkeitswahrnehmung. Blau oder grün, was macht das schon für einen Unterschied! Mir aber hat man die gesamte Wirklichkeit gestohlen, ich bin sozusagen geistig enteignet worden und befinde mich nun in einem wirklichkeitslosen Raum, allein mit den Bildern in meinem Kopf: ein Schiffbrüchiger auf dem Meer des Geistes, der allmählich in seinen inneren Sturmfluten ertrinkt.
Nicht zuletzt kann sich der Farbenblinde auch damit trösten, dass die „Wirklichkeit“ etwas sehr Relatives ist: Sehen die Fliegen die Wirklichkeit falsch, weil sie sie anders sehen? Bei mir geht es aber nicht um ein erkenntnistheoretisches Problem, sondern letztlich um Leben oder Tod. Sofern das, was ich gesehen habe, wahr ist – und warum sollte ich daran zweifeln? –, läuft irgendwo eine sadistische Mörderbande frei herum, die nur auf die Gelegenheit wartet, ein weiteres hinterhältiges Verbrechen zu begehen.
Vielleicht haben die Mörder seit meiner Verhaftung sogar längst wieder zugeschlagen. Wenn zutrifft, wovon ich ausgehen muss – dass die Täter die Spuren ihrer Verbrechen mit einer gespenstischen (weil die Wirklichkeit verdrehenden) Akribie verwischen –, kann niemand wissen, welche Bluttaten sie in der Zwischenzeit noch begangen haben.
Das Schlimme ist, dass ich langsam wirklich den Eindruck habe, den Verstand zu verlieren. Die Diagnose „geisteskrank“ wirkt wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Es macht mich buchstäblich verrückt, dass ich mit niemandem über das reden kann, was mir widerfahren ist – oder vielmehr nur so darüber reden kann, als würde es sich dabei um Wahnvorstellungen eines Junkies handeln.
Nicht nur die Tatsache an sich, dass man mich für bekloppt hält, quält mich. Dadurch, dass meinen inneren Bildern die Osmose mit der äußeren Wirklichkeit verweigert wird, haben diese in mir eine Eigendynamik entfaltet, die mich wie ein geistiges Krebsgeschwür von innen heraus zerfrisst. Die Bilder wuchern, sie gebären ständig neue Bilder, die in meinen Träumen groteske Formen annehmen und sich mit längst vergessenen Gedanken, Gefühlen, Ereignissen vermengen.
Dann stoße ich nachts diese kehligen Schreie aus, durch welche die an Alpträumen Leidenden selbst wie die Gespenster wirken, von denen sie heimgesucht werden. Ich wache schwer atmend und schweißgebadet auf und muss nach der Nachtschwester klingeln, um ein Beruhigungsmittel zu bekommen. Ein Glas Wein würde mir wahrscheinlich auch helfen, aber so etwas bekommt man hier natürlich nicht.
Dabei weiß ich genau, dass die Pflegerin der Therapeutin von dem Vorfall Bericht erstatten wird – sie ist ja verpflichtet, jeden Handgriff in eine Tabelle einzutragen. Bei der nächsten Sitzung blicke ich dann wieder in diese mitleidstriefende Ich-versteh-dich-schon-Grimasse, die mich hier wie ein verzerrtes Spiegelbild von allen Seiten anglotzt.
Ein paar Mal bin ich schon richtig ausgerastet. Das verfestigt zwar meinen Bekloppten-Status, ist andererseits aber auch eine der wenigen Freiheiten, die man hat, wenn man von Amts wegen als geisteskrank eingestuft worden ist. Und da ich scheinbar ohnehin nichts an dem Bild ändern kann, das man sich hier von mir zurechtgelegt hat, kann ich ja auch von den Vorteilen profitieren, die meine Situation mit sich bringt. Also werfe ich manchmal den Kaffeebecher an die Wand – er ist zwar nur aus Plastik, aber wenn er voll ist, gibt das trotzdem einen ziemlichen Krawall –, oder ich stoße wilde Urschreie aus, bis die Pflegerin kommt und mich beruhigt.
Natürlich mache ich das nur, wenn Magdalena da ist. Sie gehört zu der fortschrittlicheren Pflegerinnensorte, die es erst mal mit sanften Mitteln versucht, ehe sie zu Tabletten und Spritzen greift. Außerdem hat sie etwas ausgesprochen Mütterliches an sich. Mit den weichen Polstern, die ihren Körper luftkissenartig umgeben, fühlt sie sich an wie ein warmes Moosbett, das einen die Heimtücke der Welt für ein paar Augenblicke vergessen lässt. Deshalb tut es mir einfach gut, mich von Zeit zu Zeit von ihr in den Arm nehmen zu lassen.
Dann seufze ich aus tiefstem Herzen, und sie streicht mir über den Kopf wie früher meine Mama, wenn ich wieder mal beim Rollschuhfahren auf die Knie gefallen war. Ich glaube, sie weiß ganz genau, was ich mit meinen „Anfällen“ bezwecke – auch wenn es ihr wahrscheinlich lieber wäre, wenn ich meine Wünsche auf andere Weise artikulieren würde.
Aber meine Ausraster sind eben in dem sozialen Umfeld, in dem wir uns hier bewegen, der einzige Code, mit dem ich auf mein Bedürfnis nach Nähe aufmerksam machen kann. Ich kann nicht einfach zu ihr sagen: „Ach bitte, drück mich doch mal ein bisschen“ – das ist nun mal in dem gegebenen Rahmen nicht akzeptiert.
Buch (Hardcover) erscheint im Frühjahr 2024
Bild: Sarah Richter: Porträt (Pixabay)